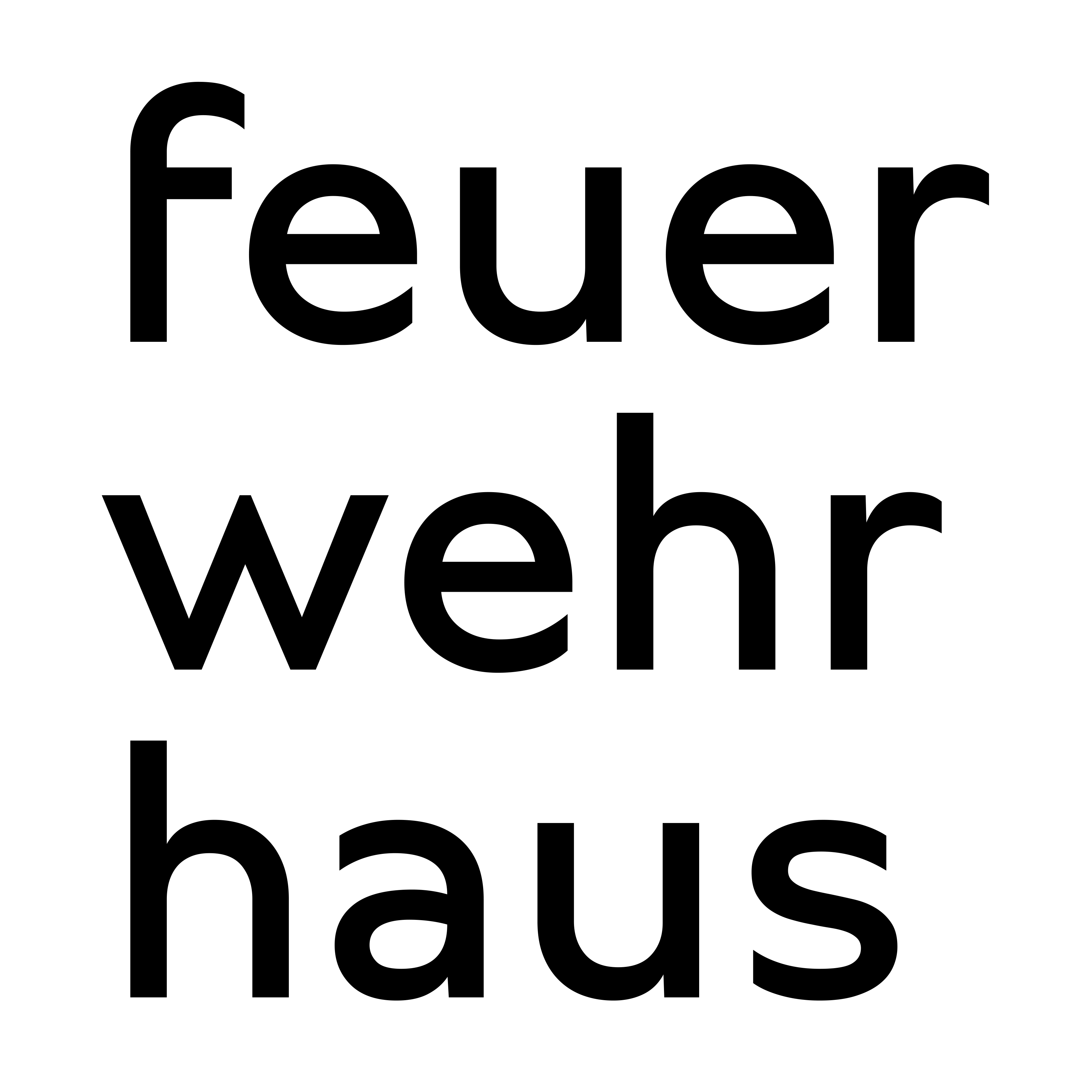Gerold Jäggle: Sehen Sie die Skulptur durch die Augen des Künstlers, dessen Anliegen die Darstellung der Bewegtheit des Zeitlaufes ist. Die Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung, die immer wieder aufs neue verteidigt werden muss, wird am Beispiel des Baltringer Haufens mit Ulrich Schmid als mutigem und besonnenem Anführer und Sebastian Lotzer als dem Schreiber der 12 Artikel dargestellt. Mit ihren Ideen von Feiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit machten sie Geschichte. Die beiden sind gleich zwei mal dargestellt: einmal obenauf als Hauptfiguren mit den 12 Artikeln. Dann in der Mitte mit der Bibel, deren Evangelium ihr Leitfaden war und auf deren Worte sie eine neue gerechtere Ordnung aufbauen wollten. Die Geschehnisse aus dem Jahr 1525 winden sich chronologisch um die knapp 4 Meter hohe Bronzeplastik. Neben den wichtigsten Protagonisten sind die vom Krieg Betroffenen dargestellt: Frauen, Kinder, Bauern, Geistliche, Landsknechte, Bürger.
Landrat Mario Glaser: "Die Idee der Freiheit war aus der Welt nicht mehr wegzukriegen."
Details: Ulrich Schmid und Sebastian Lotzer ganz oben und mittig, Bauernjörg, von Eck, Schappeler, die Waldburg, Bauern mit ihren Familien, die Fasnet als konspirativer Treff, die Versammlung im Baltringer Ried, die Landsknechtheere, die Fahne Oberschwabens, die Lanze, das Logo des Baltringer Haufens und das Emblem der „Freunde der Heimatgeschichte“, das Memminger Haus der Kramerzunft.
Den Bronzeguss der beiden Hauptfiguren oben auf der Skulptur, Ulrich Schmid und Sebastian Lotzer, wurde von Franz Gantner und Gerold Jäggle gemeinsam in Ertingen gegossen. Der Guss der großen Säule wurde von der Firma Strassacker in Süssen bei Göppingen bewerkstelligt.
Wie oft im Leben hat ein Künstler die Gelegenheit, eine Skulptur dieser Dimension zum Thema „Freiheit“ zu machen? Wahrscheinlich nur einmal. Deshalb ist es mir heute ein besonderes Anliegen, den „Freunden der Heimatgeschichte“, „Baltringer Haufen“, zu danken für das mir entgegengebrachte Vertrauen, ein Denkmal zu diesem Thema zu gestalten.
Die wichtigsten Anregungen während der Entstehung kamen von den Auftraggebern selbst, vor allem von Franz Liesch, dem Vorsitzenden der „Freunde der Heimatgeschichte“, der mit seiner detailliierten Kenntnis des Bauernkriegs im deutschen Süden den geschichtlichen Hintergrund lieferte. Ebenso wie sein Stellvertreter Franz Gantner, der unter anderem anregte, die Fahne Oberschwabens in die Skulptur zu integrieren. Für die Gemeinde Baltringen danke ich Herrn Bürgermeister Robert Hochdorfer und den Männern vom Bauhof. Dank auch an Steinmetz Alexander Städele und an das Bauunternehmen Matthäus Schmid, die den Sockel und die Fundamentierung , und am Ende auch den Kran für die Aufstellung bereitstellten.
Die Auftraggeber: „Baltringer Haufen, Freunde der Heimatgeschichte e.V.“
Gerold Jäggle
Atelier im ehemaligen Feuerwehrhaus in Ertingen
Ludwig-Grill-Str. 6, 88521 Ertingen
info@feuerwehrhaus.de
Gerold Jäggle, wie kamen Sie zur Kunst?
Gerold Jäggle: In meinem Dorf gab es keine Kunst, also auch keine Zukunft als Künstler. Die Vorstellung, einmal selbst Kunst zu machen oder gar von Kunst leben zu können, existierte nicht, Künstler waren Picasso und Dali, irgendwo fernab. Meine Mutter kaufte mir zum 14. Geburtstag eine Kamera und eine Dunkelkammer, und damit begann es. Halt, nein - es begann schon viel früher! Mir wurde früh etwas Kreatives nachgesagt, denn meine Märklin-Eisenbahn interessierte mich als gestalterische Aufgabe. Während meine Freunde Kabel verlegten, Weichen anschlossen und Loks kauften, gestaltete ich die Landschaft: meine Lok fuhr durch eine alpine Landschaft und kam auf der anderen Seite des Tunnels in einer Wüste heraus, deren Formen an amerikanische Canyons erinnerte. Zeitgleich baute ich Schiffe aus Streichhölzern statt aus Modellbausätzen.
Das war die Basis. Heinz Dress, Kunsterzieher aus Leidenschaft, erkannte mein Potenzial und förderte mich. Ich wurde vom Fleck weg an der Kunstakademie angenommen und begann, mich dort zu entwickeln. Da die Kunst bei uns im Haus als brotlos angesehen wurde, studierte ich solide auf Lehramt und machte Staatsexamen.
Gab es für Sie damals einen Plan B?
Gerold Jäggle: Mein abgeschlossenes Studium der Kunsterziehung gab mir damals die notwendige Sicherheit. Notfalls hätte ich in die Schule gehen können. Aber ich hatte dieses Aha-Erlebnis mit der Technik des Metallgusses. Die Entdeckung des „Keltischen Gusses“ mit seinen Farben und Formen faszinierte mich und führte geradewegs zum Aufbau einer Giesserei im Atelier.
Aber davor waren Sie noch bei der Bundeswehr …
Gerold Jäggle: Das stimmt. Genau auf dem Höhepunkt der Friedensbewegung, 1982, rückte ich in die Kaserne ein, erst in Manching bei Nürnberg, dann in Leipheim und später auf Kreta. Ich erinnere mich an viele Diskussionen, vor allem danach dann an der Kunstakademie, wo selbst mein Professor, Karl-Henning Seemann, gegen meine Position Stellung bezog. Das machte mir den Einstieg ins Kunststudium nicht leicht.
Waren oder wurden Sie deswegen ausgegrenzt?
Ja, so fühlte ich mich. Es hat einige Semester und einen guten Professor gebraucht, um endlich anzukommen. Die Freiheiten, die man an der Akademie hat, um sich und seinen Stil zu finden, die Werkstätten, in denen man Materialien und Techniken kennenlernt, waren am Ende stärker als die anfängliche Ablehnung und Anfeindung von Kommilitonen.
Sie arbeiten in einem außergewöhnlichen Bronzegussverfahren. Wie kam es dazu?
Gerold Jäggle: Ich habe fotografiert, gedruckt, in Gips und Ton modelliert, also alle klassischen Techniken des Kunststudiums erlernt. Aber der Metallguss mit seinen Umformungen von flüssig zu fest, von positiv zu negativ, die Energie und das Material übten einen besonderen Reiz aus. Prof. Martin Radt und Prof. Schellenberger unterstützten diese Leidenschaft und diskutierten mit mir die künstlerischen Möglichkeiten des Metallgusses. Auf der Heuneburg im Donautal bei Ertingen hatten die Kelten vor 2500 Jahren Bronze in Steinformen gegossen. Diese verschollene Technik sollte für mich zum Aha-Erlebnis werden, denn hier tat sich ein Feld auf, das ganz außergewöhnliche Farben und Formen ermöglichte. Ich begann, mich dieser Arbeit immer intensiver zu widmen und kam auf diese Weise zu meiner unverwechselbaren Handschrift, der Lebendigkeit von Metall.
Darüber würde ich gerne mehr wissen.
Gerold Jäggle: Die Technik des „Keltischen Gusses“, wie ich ihn nenne, zeigt das klassische Kunstmaterial Bronze in einem völlig neuen Licht. In dieser Technik kann man keine Denkmäler oder Monumente giessen. Hier zeigt sich die Bronze fragil, in vielfältigen Farben schimmernd, mit schwebenden Gussrändern und lebendiger Oberfläche. Die Skulpturen sind Metaphern ihres eigenen Entstehungsprozesses, sie haben im besten Fall eine magmatisch-zauberhafte Ausstrahlung. Wenn Betrachter ihre eigene Interpretation haben, z.b. „wie ein Engel“ oder „wie ein archaisches Fundstück“, ist das völlig in Ordnung. Für mich ist es der Ausdruck lebendigen Metalls.
Ist denn die Existenz als Künstler so reizvoll, wie sich das vielleicht viele vorstellen?
Gerold Jäggle: Nur 2,5 Prozent aller Akademie-Absolventen können später allein von ihrer Kunst leben. Das heisst nicht, daß es sich hier um eine schlechte Ausbildung handelt, ganz im Gegenteil: die meisten finden eine passende Tätigkeit in der Bildung, im Handwerk oder sonstwo, und sind damit wichtig für die Gesellschaft. Aber nach der Akademie ist man erst mal Einzelkämpfer, bereitet Ausstellungen vor, macht den Bürokram, die Website, entwickelt seine bildhauerische Sprache weiter. Metallguss ist zudem harte Arbeit, die mit Hitze, Lärm und Staub verbunden ist. Nach einem solchen Arbeitstag ist es wichtig, einen Ausgleich zu finden - ich spiele Tischtennis im Verein. Von Anfang an war mir klar, daß ich mit diesem Weg nicht das Klischee des Künstlers bedienen kann, der im Café die besten Ideen hat und ein dandyhaftes Leben führt. Im Gegenteil: ich behaupte, ohne Arbeitswille, Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ist dieser Beruf nicht zu schaffen.
Was wird die nächste Ausstellung Neues bringen?
Gerold Jäggle: Neue „Keltische Güsse“, neue Stiere und neue Drucke. Jede neue Ausstellung ist eine andere Herausforderung. Ich bin aber immer mehr geneigt, meine Schwerpunkte auszustellen anstatt mich mit Filmen und Dokumentationen zu zerfransen. So vielseitig ich als Künstler bin, so sehr liebe ich die Konzentration auf das Wesentliche.
Keltische Güsse
Gerold Jäggle (*1961) widmet sich in seinem Atelier im ehemaligen Ertinger Feuerwehrhaus dem Bronzeguss, wie ihn die Kelten vor etwa 2.500 Jahren auf der nahegelegenen Heuneburg zur Herstellung von Pfeil- und Speerspitzen ausgeübt haben. Er lotet die künstlerischen Möglichkeiten dieser Technik aus, um Skulpturen von intensiver Form und Farbigkeit zu gestalten. Dabei wird die Bronze mit einer Temperatur von etwa 1.150°C in eine zweiteilige Steinform gegossen, aus der die Skulptur herausgearbeitet wurde. Das Element des Zufalls spielt dabei nur scheinbar eine größere Rolle. Die Farbe wird bestimmt von der Legierung des Metalls, der Geschwindigkeit der Abkühlung als auch dem Sauerstoff, der mit dem Metall in Berührung kommt. Entscheidend ist auch die Lage der Gussform, die Temperatur der Schmelze und der Feuchtigkeitsgehalt. Stunden der Vorbereitung sind notwendig, um alle Parameter aufeinander abzustimmen. Ist der richtige Moment gekommen, so bleibt ein kurzes Zeitfenster, während dem wenige gute Exemplare entstehen können.
Meine künstlerische Vielfalt beinhaltet aber auch:
Stiere
Obwohl die Stiere als Kleinplastiken angelegt sind, wirken sie doch monumental.
Drucke
Die Drucke sind großformatige Holzschnitte, deren Ursprung in meiner Sammlung von Kanaldeckeln liegt, siehe www.schmelzgut.de
Kanal Dialäkt
Die Begegnung mit meinem Nachbarn Richard Metz führte zur YouTube-Reihe "Kanal Dialäkt", die auch als Ursprung meiner Leidenschaft für Kurzfilme gelten kann. "Kanal Dialäkt" gehört mit über 100.000 Klicks zu den erfolgreichsten Dialektfolgen überhaupt.
Portraits
Das Portraitieren ist eine Leidenschaft von mir. Zu meinen Portraitierten gehören Ernst Jünger, Martin Walser, José Saramago und Hans Liebherr, um die Bekanntesten zu nennen. Ihr findet auf dieser Seite Bilder und Geschichten, die sich mit diesen Begegnungen verbinden.
Peanuts für die Deutsche Bank
Verrückt, aber wahr: meine vielleicht wichtigste Idee wurde nie realisiert. Die "peanuts für die Deutsche Bank" wurden von Hilmar Kopper, dem Vorstandssprecher der Deutschen Bank zwar gelobt, doch für eine Realisierung fehlte der Bank der notwendige Humor. Dennoch wurden diese Peanuts so bekannt, daß meine Entwürfe und Ideen bis heute an vielen Stellen gefragt sind. So entstand aus dieser Linie z.b. die "Skulptur LNN", für die ich in Rom gemeinsam mit Wim Wenders den Premio Europeo Capo Circeo entgegennehmen durfte.
Ein Interview der Schwäbischen Zeitung gibt einen Einblick in mein Denken und meine Arbeit:
10 Fragen an Gerold Jäggle, Schwäbische Zeitung 8.8.2018
Was war Ihr Berufswunsch als Kind?
Ich habe mit der Eisenbahn gespielt und Schiffe aus Streichhölzern gebaut. Aber an einen Berufswunsch kann ich mich nicht entsinnen.
Welches Ereignis hat Sie am meisten beeindruckt?
Tiefen Eindruck hat bei mir Steve Jobs hinterlassen. Ich war dabei, als er 2007 in Paris das erste iPhone vorgestellt hat. Das Besondere daran war, daß er vom ersten Moment, als er auf die Bühne kam, ein Teil des Publikums war. Kein Vortragender, vielmehr einer von uns.
In welcher Epoche würden Sie gerne leben?
Ich interessiere mich sehr für Geschichte, aber leben möchte ich in der heutigen Zeit.
Wann haben Sie sich zum letzten Mal so richtig gefreut?
Eine große Freude überkommt mich, wenn ich spüre, daß ich die richtige Idee entwickelt habe. Das war 2017 die Skulptur „Brezeltisch“ und der „Kanal Dialäkt“, 2021 die „Barocken Köpfe“. Etwas Neues entwickeln und spüren: es passt!
Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch?
Dieses Jahr habe ich Martin Walser „Ein springender Brunnen“ wiedergelesen. Die brillante Darstellung seines Heimatdorfes Wasserburg am Bodensee in den 30-er Jahren, wie der Nationalsozialismus langsam in die Dorfgesellschaft einsickert und seine widerlichen Formen entwickelt.
Welchen Film können Sie immer wieder anschauen?
„Paper Moon“ von Peter Bogdanowitsch, mit Tatum O’Neal und Ryan O’Neal. Weitere Favoriten sind „Welcome to Wellville und „Schtonk“. Bester deutscher Film ist für mich „Das Boot“.
Verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz? Und warum sind Sie gerne dort?
Am liebsten sitze ich am Küchentisch und hecke was Neues aus.
Wem würden Sie gerne mal so richtig die Meinung sagen?
Allen, die meinen, sie wüssten es besser. Und denen, die nicht zuhören können. Und dann noch denen, die glauben, die Lösungen für heutige Probleme lägen in der Vergangenheit.
Was möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch machen?
Wenn ich morgen sterbe, dann sage ich mir: du warst glücklich, du hast gut gelebt, du hast mehr draus gemacht als man von dir erwartet hat, also was willst du noch mehr?
Wenn Sie einen Tag lang jemand anders sein könnten, wären Sie …
… ein Kelte auf der Heuneburg vor 2500 Jahren.
Gerold Jäggle: Rede zur Preisverleihung des Premio Europeo Capo Circeo am 21. Oktober 2016
Mille grazie per il Premio Europeo Capo Circeo. Ne sono honorato! Vielen Dank für diesen Preis, ich fühle mich sehr geehrt!
Ich freue mich, daß Sie mir Gelegenheit geben, mich und meine Arbeit vorzustellen. Aus der Laudatio ging hervor, daß meine vielfältigen Verknüpfungen mit europäischen Themen Anlass waren, mir diesen Preis zu verleihen. Dazu gehören meine Tätigkeiten insbesondere in England und Frankreich, aber auch in meiner Heimat. Als Beispiel nannten Sie das Europäische Bildhauersymposium in Oggelshausen. Ein Kennzeichen meiner Arbeit sei der Ausdruck „gemeinsamer europäischer kultureller Identität“.
Aus den vorhergehenden Reden ging hervor, daß dieser Preis großen Wert legt auf die europäische Integration. Insbesondere ein besseres Verhältnis zu Russland war vielen meiner Vorrednern ein wichtiges Anliegen. Es wurde deutlich, daß das gemeinsame Ziel, das wir verfolgen, die Erhaltung des Friedens ist.
Die Laudatio zu meinen Ehren brachte zum Ausdruck, daß ich diesen Preis für meine „Skulptur LNN“ erhalte, die im Auftrag der Firma Liebherr vor dem neuen Werk in Nischni Nowgorod aufgestellt wurde. Die neun Meter hohe Bronzeskulptur steht als Symbol für die guten Beziehungen zu Russland und seinen Menschen.
Isolde Liebherr und Willi Liebherr im Vorwort zum Buch „Eine Skulptur für Russland“: „Wir freuen uns, mit dieser Bronzeskulptur ein Zeichen der Völkerverständigung setzen zu können.“
Die Gestaltung der Skulptur ist bewusst dem Konstruktivismus, einer bis heute relevanten russischen Kunstbewegung der 20-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, gewidmet.
Nach der Oktoberrevolution 1917 schaute ganz Europa gespannt nach Russland, wie das kommunistische Experiment verlaufen würde. Es folgte eine Blütezeit in der Musik, Literatur, in der bildenden Kunst und in den Wissenschaften. Wladimir Tatlin (1885-1953) und Kasimir Malewitsch (1878-1935) prägten die Epoche der russischen Avantgarde. Wladimir G. Schuchow (1853-1939) entwickelte die Leichtbauweise in Stahl, die vollkommen neue Tragwerke ermöglichte.
Die Hungersnot in Russland von 1929 und die folgende Stalin-Ära setzten den fortschrittlichen Kräften ein Ende. Es folgte die Zeit der Verfolgungen, der zweite Weltkrieg, unter dem Russland litt wie kein anderes Land, dann der Kalte Krieg. Die avantgardistischen Kräfte wurden ausgeschaltet zugunsten einer ideologisch begründeten Stilrichtung, dem Sozialistischen Realismus, einer staatlich verordneten Denkmalskunst. Die Politik bestimmte fortan, was Kunst ist, wie sie auszusehen hat und wem sie dienen soll.
Die „Skulptur LNN“ knüpft an die kreativen 20-er Jahre des letzten Jahrhunderts an und schlägt einen Bogen über den sogenannten „Sozialistischen Realismus“ in die Zeit nach dem eisernen Vorhang.